
Warum Nationen entstehen und untergehen: Ein Überblick
Einführung
Dieser Essay ist die fünfte Fassung einer Überlegung, die ich vor mehr als zwei Jahrzehnten zum ersten Mal angestellt habe, nachdem ich 1999 David Landes' „The Wealth and Poverty of Nations“ gelesen hatte. Das Buch hat einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen - nicht nur wegen seines Umfangs und seiner Einsichten, sondern auch, weil es mich zwang, über die zugrunde liegenden Kräfte nachzudenken, die das Schicksal von Zivilisationen bestimmen.
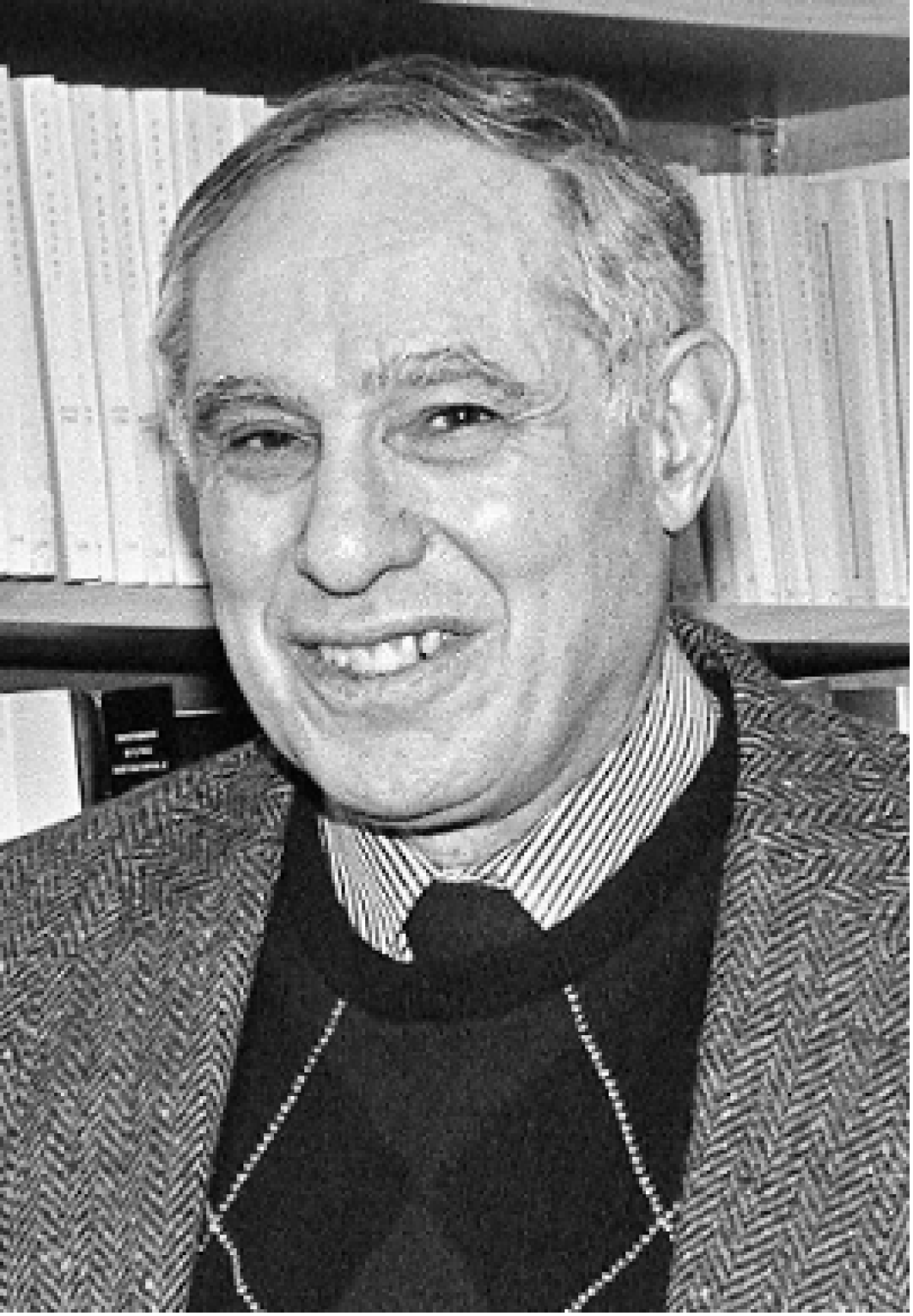
Seitdem habe ich mich immer wieder mit der Frage beschäftigt, warum Nationen aufsteigen und untergehen. Dabei habe ich mich auf die Arbeit von Wirtschaftswissenschaftlern, Historikern und Kulturkritikern gestützt, deren Ideen dazu beigetragen haben, das Thema zu erhellen. Diese kürzlich überarbeitete Version fasst Themen zusammen, die mich seit vielen Jahren beschäftigt haben. Sie soll nicht endgültig sein, sondern eher reflektierend - ein Versuch, das zu destillieren, was meiner Meinung nach am wichtigsten für das Fortbestehen oder den Zerfall von Gesellschaften ist. Für diejenigen, die sich ebenfalls für dieses Thema interessieren, habe ich am Ende des Beitrags eine Liste von Quellen zusammengestellt, die als Leitfaden für weitere Nachforschungen dienen können. Ich hoffe, dass das, was folgt, dem Leser etwas bietet, das seine Zeit und seine Gedanken wert ist.
Warum Nationen entstehen und untergehen: Ein Überblick
Im Grunde ist die Geschichte ein Bericht über den Aufstieg und Niedergang von Zivilisationen. Die Assyrer und Babylonier beherrschten einst weite Teile der antiken Welt, bevor sie in der Erinnerung verschwanden. Die Griechen legten das intellektuelle Fundament des Abendlandes, nur um dann unter der römischen Macht zu zerfallen und unterzugehen. Rom selbst, das größte Imperium der Antike, zerbrach schließlich auch unter der Last seiner eigenen Widersprüche. Jahrhunderte später stieg Spanien durch den Reichtum der Eroberung und des Silbers auf, nur um dann in Schulden und Niedergang zu versinken. Großbritannien, eine Zeit lang die dominierende Weltmacht, gab sein Imperium innerhalb einer Generation auf. Die Osmanen, die Habsburger, die Sowjets - jeder hatte seinen Moment an der Sonne, und jeder hat sich schließlich wieder verabschiedet.
Die Gründe für ihren jeweiligen Aufstieg und Niedergang mögen unterschiedlich sein - militärische Eroberung, technologische Überlegenheit, institutioneller Verfall, Invasion von außen, moralische Erschöpfung - aber das Muster ist unverkennbar. Die Geschichte ist von den Ruinen einst mächtiger Mächte übersät. Dieses wiederkehrende Phänomen hat nicht nur Historiker, sondern auch Philosophen, Theologen, Ökonomen und Staatsmänner lange Zeit fasziniert. Es ist nicht nur eine Frage der Neugierde, sondern von bleibender Bedeutung. Was lässt eine Gesellschaft gedeihen? Was führt sie zum Scheitern?
Von Ibn Khaldun[1] im 14. Jahrhundert, der über dynastische Zyklen und den Verfall der Gruppensolidarität (asabiyyah) schrieb, bis hin zu Edward Gibbons monumentalem Untergang des Römischen Reiches, der den Zerfall Roms auf moralische und institutionelle Schwäche zurückführte, hat diese Frage Generationen von Gelehrten inspiriert. In jüngerer Zeit vertrat Arnold Toynbee[2]die Ansicht, dass Zivilisationen als Reaktion auf Herausforderungen aufsteigen und durch internes Versagen untergehen. Paul Kennedy hob in The Rise and Fall of the Great Powers die Rolle von wirtschaftlicher Stärke und strategischer Übermacht hervor. David Landes, Jared Diamond und Daron Acemoglu - um nur einige zu nennen - haben diesen Gedankengang ergänzt, indem sie kulturelle, geografische und institutionelle Gesichtspunkte zum Verständnis des zivilisatorischen Schicksals einbrachten.
Die Hartnäckigkeit, mit der diese Frage aufgeworfen wird, deutet darauf hin, dass sie nicht nur akademisch ist. Dahinter verbirgt sich ein tiefer menschlicher Impuls: der Wunsch nach Beständigkeit in einer Welt des Wandels und die Hoffnung, dass wir durch das Studium der Vergangenheit die Zukunft sichern können. Die Frage, warum Nationen aufsteigen und untergehen, bedeutet auch die Frage, was die Ordnung aufrechterhält, was sie untergräbt und ob der Niedergang unvermeidlich oder vermeidbar ist. Dieser Essay ist aus diesen Überlegungen entstanden.
Die Versuchung einfacher Antworten
Wenn man mit dem Aufstieg und Niedergang von Nationen konfrontiert wird, ist es verlockend, nach einfachen, sachlichen Erklärungen zu suchen. Viele verweisen auf natürliche Ressourcen, fruchtbaren Boden, schiffbare Flüsse oder den Zugang zu Seewegen als entscheidende Vorteile. Andere betonen die technologische Überlegenheit oder die militärische Stärke. Diese Faktoren sind nicht trivial - aber sie sind auch nicht ausreichend. Die Geschichte in ihrer Gesamtheit erzählt eine komplexere Botschaft.
Der geografische Determinismus hat zum Beispiel lange Zeit Anklang gefunden. Jared Diamond führt in Guns, Germs, and Steel den Erfolg Eurasiens zu einem großen Teil auf die günstige geografische Lage zurück, einschließlich der Ost-West-Ausrichtung des Kontinents, die die Ausbreitung von Getreide, Tieren und Innovationen erleichtert hat. Das hat durchaus Erklärungskraft. Doch die Geographie kann nur bis zu einem gewissen Punkt reichen. Wie Diamond selbst einräumt,
"Die Geschichte verlief bei den verschiedenen Völkern unterschiedlich, weil es Unterschiede in der Umwelt gab, nicht weil es biologische Unterschiede zwischen den Völkern selbst gab."
(Diamond, 25).
Dennoch kann die Geographie allein nicht erklären, warum zwei Nationen mit ähnlichen Bedingungen so dramatisch divergieren. Nord- und Südkorea beispielsweise teilen dieselbe Halbinsel, Sprache und Geschichte aus der Zeit vor 1945, haben sich aber aufgrund ihrer ideologischen Entscheidungen in zwei extrem unterschiedliche Richtungen entwickelt. Auch Ghana und Singapur, die Ende der 1950er Jahre aus der britischen Kolonialherrschaft hervorgingen, hatten ein vergleichbares Einkommensniveau. Heute ist Singapur ein globales Finanzzentrum, während Ghana immer noch mit struktureller Armut und politischer Fragilität zu kämpfen hat. Der Unterschied liegt nicht im Spielraum, sondern in der Leitung, der Regierungsführung und der Kultur.
Natürliche Ressourcen werden oft als Abkürzung zum Reichtum gesehen, sind aber häufig eher ein Fluch als ein Segen. Die Silberminen von Potosí bereicherten das spanische Imperium im 16. Jahrhundert, vermochten aber keine dauerhafte industrielle Stärke zu erzeugen. Stattdessen schürten sie Inflation, Abhängigkeit und imperiale Überforderung. Das assyrische Reich, das reich an Eisen und landwirtschaftlichen Flächen war, brach aufgrund interner Revolten und externer Invasionen zusammen, nachdem seine institutionelle Kontrolle ins Wanken geraten war. In der heutigen Zeit leidet Venezuela - gesegnet mit immensen Ölreserven und anderen natürlichen Ressourcen - unter wirtschaftlichem Ruin und sozialem Zusammenbruch, während das ressourcenarme Japan mit disziplinierten Institutionen und einer Kultur der Innovation eine beeindruckende Wirtschaft aufgebaut hat.
Militärische Eroberungen sind ein weiterer irreführender Indikator für Erfolg. Das Römische Reich erreichte eine beispiellose territoriale Ausdehnung, doch wie Gibbon argumentierte, ebnete sein innerer Verfall an bürgerlicher Tugend, institutioneller Kohärenz und administrativer Kompetenz den Weg für seinen Zerfall. Das Mongolenreich, das vielleicht größte zusammenhängende Landreich der Geschichte, verschwand innerhalb einer Generation aus ähnlichen Gründen: Es eroberte, aber es hatte keinen Zusammenhalt.
Auch technologische Überlegenheit ist keine Garantie für eine dauerhafte Vorherrschaft. Das abbasidische Kalifat übertraf in seinem goldenen Zeitalter Europa in Wissenschaft, Mathematik und Literatur. Doch ohne institutionelle Erneuerung und Anpassungsfähigkeit kam sein Fortschritt zum Stillstand. Wenn Innovation nicht durch kulturelle Werte unterstützt wird, die Forschung belohnen und Dissens tolerieren, neigt sie dazu, zu verblassen.
Der Wirtschaftswissenschaftler William Easterly hat es kurz und bündig formuliert: "Arme Länder sind nicht wegen der Tropen arm, sondern wegen ihrer schlechten Institutionen. Geographie ist kein Schicksal" (Easterly 254). David Landes schließt sich dieser Meinung an: "Das bloße Vorhandensein von Reichtum macht eine Gesellschaft nicht reich. Es kann die Bemühungen sogar behindern, indem es die Illusion von Reichtum ohne Arbeit schafft" (Landes 516).
Selbst Fernand Braudel, dem die lange Spanne der Geschichte nicht fremd war, warnte vor geografischem Fatalismus. „Geographie ist keine Erklärung“, schrieb er. „Sie ist eine Einladung.“ Die tieferen Gründe für den Erfolg oder Misserfolg eines Landes liegen woanders - in der Art und Weise, wie Gesellschaften organisiert sind, wie sie Werte vermitteln, in der Qualität ihrer Gesetze und im Charakter ihrer Bürger.
Die materialistischen Erklärungen mögen mit Einfachheit locken, aber sie lassen uns an der Oberfläche kreisen. Die wahren Ursachen liegen tiefer.
Landes und der kulturelle Kern
Wenn materielle Faktoren allein nicht für das Schicksal von Nationen verantwortlich sind, was dann? In The Wealth and Poverty of Nations gibt der Historiker David Landes[3] eine eindrucksvolle Antwort: Die entscheidenden Elemente liegen nicht in dem, was eine Gesellschaft hat, sondern in dem, was sie ist. „Beim Streben nach Reichtum“, schreibt Landes, „werden Misserfolg oder Erfolg letztlich von innen bestimmt, nicht von außen aufgezwungen“ (Landes, 523). Das heißt, die Kultur - im weitesten Sinne definiert als die Werte, Gewohnheiten, Überzeugungen und institutionellen Erwartungen einer Gesellschaft - prägt ihre Fähigkeit, zu gedeihen oder zu verfallen.
Landes identifiziert acht miteinander verflochtene Eigenschaften, die für den zivilisatorischen Erfolg entscheidend sind. Keines dieser Merkmale ist für sich allein ausreichend, und alle erfordern historische Anstrengungen, um sich zu entwickeln und zu erhalten. Betrachten wir sie nacheinander, zusammen mit illustrativen Einblicken in die Geschichte.
1. Ein Bewusstsein für den nationalen Zusammenhalt
Nationaler Zusammenhalt ist keine bloße Sentimentalität oder Fahnenschwenkerei. Es ist die Fähigkeit verschiedener Gruppen innerhalb eines Staates, engere Loyalitäten einer gemeinsamen staatsbürgerlichen Identität unterzuordnen.
"Nationaler Zusammenhalt, ein Gefühl der Zugehörigkeit und der Verantwortung füreinander, ist für den Aufbau und die Aufrechterhaltung wirtschaftlicher Anstrengungen unerlässlich."
(Landes, 524).
Wenn sie fehlt, werden selbst die besten Gesetze durch Fraktionszwang untergraben. Denken Sie an die frühen Vereinigten Staaten: eine neue Nation, die sich aus verschiedenen Kolonien zusammensetzte und die ihren Zusammenhalt durch einen gemeinsamen Verfassungsrahmen und eine Kultur der republikanischen Tugenden festigte. Im Gegensatz dazu ist das Habsburger Reich - multinational und multiethnisch - im 19. und frühen 20. Jahrhundert zerbrochen, weil es nicht in der Lage war, die Einheit zwischen seinen Bestandteilen zu fördern.
2. Die Fähigkeit zu Wettbewerb
Wettbewerb bedeutet nicht nur Ehrgeiz, sondern auch Anpassungsfähigkeit. Erfolgreiche Gesellschaften kultivieren ein Ethos des Strebens, des Experimentierens und der Widerstandsfähigkeit. Das Japan der Post-Meiji-Zeit (nach 1868) bietet ein anschauliches Beispiel. Angesichts der westlichen Industriemacht reformierte Japan rasch seine Institutionen, übernahm westliche Technologien und baute innerhalb weniger Jahrzehnte eine Produktionsbasis von Weltrang auf. Im Gegensatz dazu widersetzte sich das China der Qing-Dynastie trotz seiner Größe und Ressourcen den Reformen und geriet ins Hintertreffen - und litt schließlich unter ausländischer Vorherrschaft.
3. Wertschätzung für empirisches und technisches Wissen und die Bereitschaft, dieses zu übertragen
Wohlhabende Gesellschaften legen Wert auf praktisches Lernen. Sie bilden Ingenieure, Handwerker und Problemlöser aus - nicht nur Theoretiker oder Bürokraten.
"Wissenschaftliche Neugier und technologischer Einfallsreichtum sind unverzichtbar; sie werden nur dann produktiv, wenn sie mit einer Kultur verbunden sind, die praktisches Wissen schätzt und weitergibt.
(Landes 516)
Diese Eigenschaft erklärt einen Teil der europäischen Divergenz während der industriellen Revolution. Die britischen Institutionen wie die Royal Society förderten empirische Forschung und deren Verbreitung in der Industrie. Im Osmanischen Reich hingegen wurde der Buchdruck jahrhundertelang aus religiösen Gründen abgelehnt, was die Verbreitung des Wissens verzögerte.
4. Vorrang der Beförderung nach Verdienst oder Kompetenz
Meritokratie, auch wenn sie nirgendwo perfekt umgesetzt wird, ist entscheidend für die langfristige Gesundheit eines Landes. Wenn der Status auf Talent und Anstrengung beruht und nicht auf Geburt oder Gönnerschaft, schöpft eine Gesellschaft das volle Potenzial ihrer Bürger aus.
"Gesellschaften, die Leistung mehr als Privilegien und Erfolg mehr als Abstammung schätzten, waren eher in der Lage, zu innovieren und zu wachsen.
(Landes 515)
Der preußische öffentliche Dienst wurde im 19. Jahrhundert zu einem Musterbeispiel für bürokratische Effizienz, da die Einstellung auf der Grundlage von Prüfungen und Fähigkeiten erfolgte. Vergleichen Sie dies mit dem modernen Libanon (und anderen Ländern), wo konfessionelle Quoten und klientelistische Netzwerke die öffentliche Verwaltung ausgehöhlt haben, obwohl das Land über ein beträchtliches Arbeitskräftepotenzial verfügt.
5. Ein Gemeinwesen, das in der Lage ist, Reichtum nicht nur zu erwerben, sondern auch zu nutzen
Reichtum, so argumentiert Landes, muss nicht nur erworben, sondern auch produktiv eingesetzt werden. Dies erfordert finanzielle Kompetenz, ethische Normen und eine langfristige Vision.
"Wohlstand muss erst geschaffen werden, bevor er konsumiert werden kann, und die Gesellschaften, die lernen zu investieren und zu sparen, werden überleben.
(Landes, paraphrased from p. 517).
In der Schweiz hat die Kultur der Sparsamkeit, des Sparens und des dezentralen Unternehmertums ein gebirgiges, ressourcenarmes Land in eine wohlhabende und stabile Gesellschaft verwandelt. Im ölreichen Nigeria hingegen wurde der enorme Reichtum durch Korruption und Konsum vergeudet, ohne dass viel in dauerhaftes Kapital investiert wurde.
6. Allgemeiner Respekt für Ehrlichkeit
Vertrauen ist das Schmiermittel des wirtschaftlichen und bürgerlichen Lebens. In Gesellschaften mit geringem Vertrauen muss jede Transaktion bewacht, überwacht und durchgesetzt werden - zu hohen Kosten.
„Vertrauen, Ehrlichkeit und Rechtsstaatlichkeit senken die Transaktionskosten, fördern den Austausch und begünstigen Investitionen“
(Landes 516)
Die nordischen Länder gehören durchweg zu den am wenigsten korrupten Ländern, und ihre öffentlichen Institutionen genießen großes Vertrauen. Dieses Vertrauen ermöglicht einen reibungslosen Handel, effiziente Regierungsführung und Innovation. Im Gegensatz dazu untergräbt die systemische Korruption in vielen Teilen der Dritten Welt sowohl inländische als auch ausländische Investitionen und verstärkt den Zynismus.
7. Staatliche Institutionen, die Eigentum sichern und Unternehmertum belohnen
Sichere Eigentumsrechte und Rechtsstaatlichkeit sind Voraussetzungen für nachhaltiges Unternehmertum. Ohne sie verkümmern Investitionen und die Zukunft wird ungewiss.
"Wirtschaftswachstum erfordert vor allem sichere Eigentumsrechte, eine ehrliche Regierung und ein Klima der Gerechtigkeit und Ordnung.
(Landes 523)
Diese Einsicht eint so unterschiedliche Denker wie Wilhelm Röpke und Hernando de Soto. Röpke schrieb: „Nur wenn die Eigentumsrechte geschützt sind, bleibt Raum für persönliche Unabhängigkeit und Verantwortung“ (Röpke 85). De Soto hat gezeigt, wie Milliarden von Menschen vom Wohlstand ausgeschlossen bleiben, weil sie keinen formalen Anspruch auf Land oder Kapital haben. Länder wie Chile und Estland haben durch institutionelle Reformen die Eigentumsrechte verbessert und eine rasante Entwicklung erlebt. Andere, wie Simbabwe, erlebten einen wirtschaftlichen Zusammenbruch, nachdem Eigentumsbeschlagnahmungen das Vertrauen und das Kapital zerstört hatten.
8. Disziplin, auf gegenwärtigen Konsum für zukünftigen Gewinn zu verzichten
Das letzte Merkmal - und wohl auch das fragilste - ist die kulturelle Fähigkeit, die Belohnung hinauszuzögern. Gesellschaften, die sparen, investieren und planen, können aufbauen. Gesellschaften, die sofortige Belohnung verlangen, zerstören oft ihre Zukunft.
"Die Disziplin, zu sparen und zu investieren, anstatt alles zu konsumieren, die Befriedigung aufzuschieben, ist für eine langfristige Entwicklung unerlässlich.
(Landes 518)
Deutschlands Aufschwung in der Nachkriegszeit beruhte zum Teil auf einer tiefen kulturellen Verankerung von Sparsamkeit, Bildung und schrittweisem Fortschritt - dem sogenannten Wirtschaftswunder. Argentinien hingegen, das einst zu den reichsten Nationen der Welt gehörte, hat ein Jahrhundert des Niedergangs hinter sich, das von Populismus, Schuldenzyklen und Kurzsichtigkeit geprägt war.
Es ist klar, dass diese Merkmale zusammengenommen nicht spontan entstanden sind. Sie sind das Ergebnis eines langen historischen Kampfes, kultureller Bemühungen und institutioneller Verfeinerung. Sie sind auch zerbrechlich und erodieren leicht, wenn sie vernachlässigt oder verhöhnt werden. Wie Landes betont: „Wenn wir etwas aus der Geschichte der wirtschaftlichen Entwicklung lernen, dann ist es, dass die Kultur den Unterschied ausmacht“ (Landes 516).
Im Folgenden wollen wir untersuchen, wie sich diese kulturellen Grundlagen mit den institutionellen Strukturen, die von anderen prominenten Denkern hervorgehoben wurden, überschneiden und wie sie durch diese verstärkt oder untergraben werden.
Andere Stimmen
David Landes ist nicht der Einzige, der die kulturellen Wurzeln des Wohlstands aufzeigt. Er gehört zu einem breiteren Chor von Ökonomen, Historikern, politischen Theoretikern und Soziologen, von denen viele die entscheidende Rolle von Institutionen, Recht und Freiheit bei der Gestaltung des Schicksals von Nationen hervorgehoben haben.
In Why Nations Fail stellen Daron Acemoglu und James A. Robinson eine starke institutionelle These auf: Nationen gedeihen, wenn sie integrative Institutionen entwickeln, die Eigentumsrechte schützen, Verträge durchsetzen, Investitionen fördern und Chancengleichheit bieten. Im Gegensatz dazu führen extraktive Institutionen - also solche, die Macht und Reichtum in den Händen weniger konzentrieren - zu Stagnation.
"Länder wie Nordkorea sind arm, weil diejenigen, die die Macht haben, Entscheidungen treffen, die zu Armut führen. Sie machen es nicht aus Versehen oder Unwissenheit falsch, sondern mit Absicht."
(Acemoglu and Robinson 68)
Dies erinnert, modern ausgedrückt, an die Erkenntnisse von Douglass North, der betonte, dass Institutionen die wirtschaftliche Leistung durch die Strukturierung von Anreizen beeinflussen. North argumentierte, dass die langfristige Entwicklung von der Schaffung von Institutionen abhängt, die den privaten Nutzen mit dem öffentlichen Wohl in Einklang bringen. Sichere Eigentumsrechte, die unparteiische Durchsetzung von Verträgen und die Einschränkung willkürlicher Macht sind kein Luxus, sondern eine entscheidende Notwendigkeit.
Es ist erwähnenswert, dass die Rechtsstaatlichkeit ein besonders dauerhafter Motor des Wohlstands war. Der Rechtswissenschaftler Harold Berman hat in Law and Revolution festgestellt, dass der Wandel Westeuropas zu einer dynamischen Zivilisation mit der Entstehung autonomer, von Kirche und Krone unabhängiger Rechtssysteme zusammenfiel. Diese Systeme boten Vorhersehbarkeit, Rückgriff und Rechenschaftspflicht - Bedingungen, unter denen Unternehmen florieren konnten.
Auch das Privateigentum ist mehr als ein technisches Gut - es ist eine kulturelle Institution. Wie Friedrich Hayek argumentierte: „Das System des Privateigentums ist die wichtigste Garantie der Freiheit, nicht nur für diejenigen, die Eigentum besitzen, sondern kaum weniger für diejenigen, die es nicht besitzen“ (Hayek 107). Eigentumsrechte schaffen nicht nur wirtschaftliche Anreize, sondern auch soziale Stabilität: Menschen mit sicherem Eigentum sind eher bereit zu planen, zu sparen und zu investieren.
Röpke - einer der Architekten der deutschen Wirtschaftsreform der Nachkriegszeit - stellte das Privateigentum und die Dezentralisierung in den Mittelpunkt seiner „“Humanwirtschaft„“. Er warnte davor, dass das moralische und zivile Gefüge der Gesellschaft zerfällt, wenn der Staat zum alleinigen Versorger und Planer wird. In seinen Worten: „Wo alles zentralisiert ist, wird das Leben unmenschlich und gefährlich“ (Röpke 145). Sein Kollege Alexander Rüstow prägte den Begriff der Vitalpolitik, die darauf abzielte, wirtschaftliche Freiheit in kulturelle Gesundheit und moralische Verantwortung einzubetten.
Freiheit im weiteren Sinne wird seit langem als Voraussetzung für kreative Entfaltung verstanden. Alexis de Tocqueville warnte davor, dass Demokratien ungewollt in einen „sanften Despotismus“ abdriften könnten - eine bürokratische Bevormundung, die unter dem Deckmantel der Sicherheit die Initiative erstickt. Tocqueville fürchtete nicht die Tyrannei durch Gewalt, sondern eine passive Bürgerschaft, die bereit ist, Eigenverantwortung gegen Komfort einzutauschen. „Die Art der Unterdrückung, mit der demokratische Völker bedroht sind, wird mit nichts vergleichbar sein, was ihr in der Welt vorausgegangen ist“, schrieb er (Demokratie in Amerika, Band II, Teil IV, Kap. 6).
Die Österreichische Schule der Nationalökonomie - Ludwig von Mises, Friedrich Hayek und später Hans-Hermann Hoppe - trieb diese Erkenntnis weiter voran. Mises argumentierte, dass rationales wirtschaftliches Kalkül marktwirtschaftliche Preise voraussetzt, die wiederum einen freiwilligen Austausch und sichere Eigentumsverhältnisse erfordern. Hayek fügte hinzu, dass Wissen dezentralisiert und stillschweigend vorhanden ist, was eine zentrale Planung nicht nur ineffizient, sondern auch epistemologisch unmöglich macht. Hoppe, der sich auf eine radikalere libertäre Tradition beruft, bestand darauf, dass ohne die absolute Achtung des Privateigentums die Zivilisation selbst in Konflikten zusammenbricht.
Die Dezentralisierung wird somit zu einem wichtigen Thema. Ob politisch, rechtlich oder wirtschaftlich, dezentralisierte Systeme ermöglichen lokales Wissen, Widerstandsfähigkeit und Wettbewerb. Die Schweizerische Eidgenossenschaft mit ihrer kantonalen Autonomie und ihren Bürgerversammlungen ist seit langem ein Beweis für die Stärke der Subsidiarität. Die Hanse, ein dezentralisiertes Netzwerk von Handelsstädten im mittelalterlichen Europa, florierte ohne eine zentrale Behörde, weil ihre Institutionen anpassungsfähig und freiwillig waren und sich an Handelsnormen orientierten.
Selbst Denker wie Hernando de Soto, der in Entwicklungsländern arbeitet, haben dafür plädiert, dass die rechtliche Anerkennung von informellem Eigentum von zentraler Bedeutung für die Freisetzung von Kapital ist. In Das Geheimnis des Kapitals zeigt de Soto, dass Milliarden von Menschen Vermögenswerte besitzen, die sie jedoch ohne formale Eigentumsrechte nicht in produktives Kapital umwandeln können. Was wie ein bürokratisches Problem aussieht, ist in Wirklichkeit ein zivilisatorisches Problem.
Über Jahrhunderte und unterschiedliche Disziplinen hinweg gilt: Die Freiheit des Rechts - gestützt auf Eigentumsrechte, auf unabhängige Institutionen und auf moralische Normen - ist der Boden, auf dem Wohlstand wächst.
Diese Argumente stützen die These von Landes eher, als dass sie ihr widersprechen. Die Geographie mag die anfänglichen Bedingungen des Spiels bestimmen. Die Kultur mag das Temperament der Spieler prägen. Aber es sind die Institutionen - die Regeln, die Schiedsrichter und das Ethos des Wettbewerbs - die letztendlich darüber entscheiden, ob eine Gesellschaft vorankommt oder untergeht.
Vergessen wir die Erfolgsformel?
Wenn Landes Recht hat - und wenn der Wohlstand aus tiefgreifenden kulturellen und institutionellen Merkmalen resultiert - dann werden wir uns im modernen Westen mit sehr unbequemen Fragen auseinandersetzen müssen. Denn das, was er als die Grundlagen des Erfolgs bezeichnete - Disziplin, Ehrlichkeit, Leistungsgesellschaft, Respekt vor dem Eigentum, bürgerlicher Zusammenhalt - wird nicht nur vernachlässigt. Sie werden aktiv demontiert.
Die Anzeichen sind kaum zu übersehen. Die Meritokratie wurde auf dem Altar der „Gleichheit“, der ‚Inklusion‘ und der „sozialen Gerechtigkeit“, der ideologischen Quoten, geopfert. Wissenschaft und Bildung sind politisiert worden, was das Vertrauen in die Expertise untergräbt. Öffentliche und private Schulden sind zu einem festen Bestandteil der Politik geworden - in einem Ausmaß, das früher undenkbar war, ohne die Absicht der Rückzahlung und ohne einen glaubwürdigen Plan, den Kurs zu ändern. Unehrlichkeit im öffentlichen Leben ist nicht mehr schockierend; sie wird vorausgesetzt und erwartet. Langfristiges Denken wird von der Kultur des Spektakels, der Ablenkung und der kurzfristigen Belohnung verdrängt. Wir haben das von früheren Generationen angehäufte Kapital - moralisch, steuerlich und kulturell - aufgezehrt, während wir uns zu unserem Fortschritt beglückwünschen.
Dies ist nicht nur ein Niedergang. Es ist das, was Landes als zivilisatorische Amnesie bezeichnen würde.
Kulturelle Kohäsion und ihre Auflösung
Landes betonte den nationalen Zusammenhalt als wichtige Eigenschaft. Heute jedoch ist die westliche Welt - insbesondere die Vereinigten Staaten - eher durch Fragmentierung als durch Einheit gekennzeichnet. Die Identitätspolitik lässt Gruppen in einem Nullsummenspiel gegeneinander antreten, während gemeinsame Symbole, Erzählungen und bürgerliche Rituale erodiert sind. Migration ohne Integration hat die sozialen Bindungen ausgefranst. Tocquevilles „milder Despotismus“ ist nicht länger eine Warnung, sondern ein Beleg, und die Idee eines gemeinsamen Ziels wird mit Misstrauen oder Spott behandelt.
Rothbard hat vor diesem Ergebnis gewarnt. In seiner Kritik an der Staatsmacht stellte er fest, dass der Staat, wenn er zum Schiedsrichter der Identität und zum Anbieter von Leistungen wird, den Gruppenkrieg fördert:
„Je mehr der Staat einnimmt, desto mehr müssen sich die verschiedenen Gruppen nehmen, was sie können, bevor die Beute ausgeht“
(Rothbard, Power and Market, 175).
Viele sind der Ansicht, dass die kulturelle Fragmentierung nicht zufällig, sondern systembedingt ist.
Geldvernichtung und der Verlust der Zukunftsfähigkeit
Vielleicht veranschaulicht nichts die Erosion der achten Eigenschaft von Landes - die Disziplin, auf gegenwärtigen Konsum zugunsten zukünftiger Gewinne zu verzichten - besser als die monetäre Entwicklung des Westens. Einst durch Gold und fiskalische Umsicht verankert, ist die moderne Geldpolitik zu einer Praxis der Verleugnung geworden. Die Schulden steigen, die Zinssätze sind verzerrt, und die Idee des gesunden Geldes wird als Anachronismus verspottet.
Rothbard sah darin, wie schon Mises und Hayek vor ihm, keinen technischen, sondern einen moralischen Fehler. Er schrieb:
„Inflation ist eine versteckte Steuer und eine Form der legalisierten Falschmünzerei“.
(Rothbard, What Has Government Done to Our Money? 39).
Sie bestraft die Sparer, belohnt die Spekulation und untergräbt das Vertrauen. Landes würde zustimmen: Eine Gesellschaft, die sich finanziell nicht zügeln kann, hat das für den Wohlstand notwendige kulturelle Temperament verloren.
Militarismus und der Zerfall der Freiheit
Ein weiteres zersetzendes Element ist die Rückkehr des Militarismus - nicht in Form einer heroischen Verteidigung, sondern als permanenter Zustand der Intervention. In der Ära nach dem 11. September 2001 haben die westlichen Mächte, insbesondere die Vereinigten Staaten, ständig Kriege mit zweifelhaften strategischen oder moralischen Ergebnissen geführt. Die Folgen sind vielfältig: aufgeblähte Verteidigungsbudgets, erweiterte Überwachung, Aushöhlung der bürgerlichen Freiheiten und eine Ausweitung der Notstandsbefugnisse.
Der Historiker Paul Kennedy warnte vor „imperialer Überdehnung“ - der Tendenz von Großmächten, sich durch exzessives militärisches Engagement zu erschöpfen. Auch Landes würde solche Muster als Anzeichen für fehlgeleitete Ressourcen und nachlassende interne Disziplin betrachten.
Rothbard verurteilte den Krieg als „die Gesundheit des Staates“, in Anlehnung an Randolph Bourne. Krieg, so argumentierte er, zentralisiert die Macht, entschuldigt Tyrannei und lenkt die Produktion von friedlichen Unternehmungen auf Zerstörung um. Eine Kultur, die sich dem langfristigen Wohlstand verschrieben hat, kann sich keine permanente Kriegswirtschaft leisten.
Der Mythos vom Exzeptionalismus
Einem Großteil dieses institutionellen Verfalls liegt ein selbstgefälliger Glaube an den „Exzeptionalismus“ zugrunde - die Vorstellung, dass bestimmte Nationen, insbesondere die Vereinigten Staaten, gegen die Gesetze der Geschichte immun sind. Diese Wahnvorstellung erlaubt es, fiskalische Vorsicht außer Kraft zu setzen, verfassungsrechtliche Grenzen außer Acht zu lassen und davon auszugehen, dass der Niedergang etwas ist, das anderswo passiert und nicht hier.
Aber Landes' Rahmenwerk bietet keine solchen Ausnahmen. Wohlstand ist kein Geburtsrecht, sondern er muss verdient, gepflegt und geschützt werden. Seine Voraussetzungen - Ehrlichkeit, Sparsamkeit, Wettbewerb, sicheres Eigentum und eine leistungsorientierte Gesellschaft - erhalten sich nicht von selbst. Sie müssen gelehrt, verteidigt und manchmal unter großem Aufwand wiedergewonnen werden.
Rothbard stellte eine klare Diagnose: "Es gibt keine größere Illusion als die Vorstellung, dass ein politisches System oder eine Kultur zu groß ist, um zu scheitern. Leviathane fallen genauso wie Republiken, wenn die moralischen Grundlagen erodieren" (Rothbard, Für eine neue Freiheit 211).
Institutioneller Zerfall im Kontext
All diese Entwicklungen - geldpolitische Verantwortungslosigkeit, kulturelle Zersplitterung, politisierte Bildung, permanente Kriegsführung und nicht nachhaltige Verschuldung - können als Symptome eines institutionellen und kulturellen Abdriftens verstanden werden. Sie sind das Gegenteil der acht Tugenden von Landes. Wo westliche Gesellschaften einst Selbstbeherrschung, Kompetenz und langfristige Planung schätzten, verherrlichen sie heute Emotionen, Empörung und Improvisation.
Was Landes anbot, war eine moralische Sichtweise. Er sagte nicht den Untergang voraus, aber er warnte, dass ohne Wachsamkeit der Untergang unvermeidlich ist. Der Verlust von Disziplin, Ehrlichkeit und Zusammenhalt ist nicht nur ein politisches Problem, sondern ein zivilisatorisches.
Epilog
Nationen brechen nicht über Nacht zusammen, auch nicht durch Zufall. Ihr Untergang ist selten das Ergebnis eines einzelnen Krieges, eines schlechten Herrschers oder eines unglücklichen Ereignisses. Viel häufiger ist es die langsame Anhäufung von Entscheidungen, die getroffen wurden: die verlorenen Tugenden, der ausgehöhlte Charakter und die ignorierten Grundfesten.
Landes warnte, dass Erfolg verdient, nicht geerbt, aufgebaut, nicht erwartet werden sollte. Zivilisationen erheben sich aufgrund von Disziplin, Ehrlichkeit, Verdienst, Wissen und Weitsicht. Sie fallen, wenn diese Eigenschaften verspottet, weggeworfen oder vergessen werden. Das Muster ist nicht mysteriös. Es ist ein historisches Gesetz.
Am 10. Januar 1917 schickte Theodore Roosevelt einen Brief an S. Stanwood Menken, der den folgenden prophetischen Absatz enthält:
"Amerikanismus bedeutet die Tugenden Mut, Ehre, Gerechtigkeit, Wahrheit, Aufrichtigkeit und Hartnäckigkeit - die Tugenden, die Amerika geschaffen haben. Die Dinge, die Amerika zerstören werden, sind Wohlstand-um-jeden-Preis, Frieden-um-jeden-Preis, Sicherheit-vorrangig statt Pflicht-vorrangig, die Liebe zum sanften Leben und die Theorie des schnellen Reichtums im Leben. [4]"
Theodore Roosevelt
Im Gegensatz zur materiellen Zerstörung, die oft wieder aufgebaut werden kann, verläuft der moralische und institutionelle Verfall auf subtilere Art und Weise. Er nährt sich von Bequemlichkeit, verstärkt Schwächen und widersteht der Korrektur. Sobald eine Gesellschaft ihre Fähigkeit zur Selbstbeherrschung verliert, sobald sie das Vergnügen über das Prinzip, die Erzählung über die Wahrheit und den Anspruch über die Anstrengung stellt, gerät sie in einen Kreislauf, aus dem die Geschichte nur wenige schmerzfreie Auswege bietet.
In diesem Sinne ist der Niedergang kein politischer Fehler. Er ist keine Panne. Er ist die natürliche Folge früherer Nachsichtigkeiten - die letzte Stufe einer langen Kette moralischer Zugeständnisse und kultureller Verzichte. So wie der finanzielle Bankrott allmählich beginnt und plötzlich endet, so ist auch der zivilisatorische Niedergang.
Auch hier hat Rothbard den Kern der Sache auf den Punkt gebracht: "Die große Krise unseres Zeitalters ist nicht eine des Wissens, sondern eine des Mutes. Nicht was wir tun sollen, sondern ob wir es tun werden." Darin liegt das schmale Portal zur Erneuerung. Es sind nicht Reformen, Technokratie oder kluges Regieren, die den Niedergang umkehren. Es ist die Wiederentdeckung von Tugenden, die einst als überholt galten: Sparsamkeit, Wahrheit, Pflicht, Ehre.
Aber die Erneuerung, wenn sie denn kommt, fordert einen Preis. Sie erfordert Opfer, Klarheit und die Abkehr von bequemen Illusionen. Die meisten Gesellschaften, die sich an ihre Dekadenz gewöhnt haben, können und wollen diesen Preis nicht entrichten.
Die Geschichte trauert nicht um ihr Ableben. Sie geht einfach weiter.
Für diejenigen unter uns, denen es nicht nur um das Kapital, sondern um die Zivilisation geht - sei es als Investoren, Bürger, Eltern oder Erben - sind die wichtigsten Indikatoren also möglicherweise nicht das BIP-Wachstum oder die Zinssätze. Sie könnten stattdessen tiefer liegen: in der Stärke der Institutionen, der Ehrlichkeit des Diskurses, dem Zusammenhalt der Kultur und dem moralischen Durchhaltevermögen der Menschen.
Das Glück folgt dem Charakter. Und wenn der Charakter schwindet, wird der Ruin nicht aufgezwungen. Er wird eingeladen.
Ὁ νοῶν νοείτω.
(„Wer versteht, lass ihn verstehen“)
[1] Ibn Khaldun (1332-1406) war ein nordafrikanischer arabischer Historiker, Philosoph und Staatsmann, der vor allem für die Muqaddimah bekannt ist, ein bahnbrechendes Werk der historischen Analyse aus dem Jahr 1377. Darin führte er eine zyklische Theorie des Aufstiegs und Niedergangs von Zivilisationen ein, die auf dem Konzept der asabiyyah (sozialer Zusammenhalt) basiert, und betonte die Rolle wirtschaftlicher, kultureller und institutioneller Faktoren bei der Gestaltung der Geschichte. Ibn Khaldun gilt weithin als Vorläufer der modernen Soziologie. Seine Erkenntnisse über Macht, Verfall und gesellschaftliche Dynamik sind nach wie vor von großer Bedeutung.
[2] Arnold J. Toynbee (1889-1975) war ein britischer Historiker und Wissenschaftler für internationale Angelegenheiten, der vor allem für sein 12-bändiges Werk A Study of History (1934-1961) bekannt ist. Darin untersuchte er den Aufstieg und Fall von Zivilisationen anhand eines vergleichenden Rahmens und vertrat die Ansicht, dass Gesellschaften aufblühen, wenn sie kreativ auf Herausforderungen reagieren, und untergehen, wenn sie dem inneren Verfall erliegen oder sich nicht anpassen können. Toynbees weitreichende Vision und seine Betonung der moralischen und geistigen Vitalität machten ihn zu einem der einflussreichsten historischen Denker des 20. Jahrhunderts.
[3] David S. Landes (1924-2013) war ein amerikanischer Wirtschaftshistoriker und Professor an der Harvard University, der für seine Arbeiten zur industriellen Entwicklung und zur Wirtschaftsgeschichte der Nationen bekannt ist. Sein einflussreichstes Buch, The Wealth and Poverty of Nations (1998), untersucht, warum einige Länder anhaltenden Wohlstand erreichen, während andere arm bleiben, und löste eine breite Debatte in allen Disziplinen aus. Es ist jenes Buch, das mein ungebrochenes Interesse an diesem Thema geweckt hat.
[4] https://history.stackexchange.com/questions/14706/did-theodore-roosevelt-ever-say-the-things-that-will-destroy-america-quote?
Zitierte Werke
Acemoglu, Daron, and James A. Robinson. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Crown Business, 2012.
Berman, Harold J. Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition. Harvard University Press, 1983.
Braudel, Fernand. On History. Translated by Sarah Matthews, University of Chicago Press, 1980.
De Soto, Hernando. The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else. Basic Books, 2000.
Diamond, Jared. Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies. W. W. Norton & Company, 1997.
Easterly, William. The Elusive Quest for Growth: Economists’ Adventures and Misadventures in the Tropics. MIT Press, 2001.
Gibbon, Edward. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. Edited by David Womersley, Penguin Classics, 1994.
Hayek, Friedrich A. The Road to Serfdom. University of Chicago Press, 2007.
Hoppe, Hans-Hermann. A Theory of Socialism and Capitalism: Economics, Politics, and Ethics. Mises Institute, 2010.
Kennedy, Paul. The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. Vintage, 1989.
Khaldun, Ibn. The Muqaddimah: An Introduction to History. Translated by Franz Rosenthal, edited by N. J. Dawood, Princeton University Press, 2015.
Landes, David S. The Wealth and Poverty of Nations: Why Some Are So Rich and Some So Poor. W. W. Norton & Company, 1998.
Mises, Ludwig von. Human Action: A Treatise on Economics. Ludwig von Mises Institute, 1998.
North, Douglass C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press, 1990.
Röpke, Wilhelm. A Humane Economy: The Social Framework of the Free Market. Liberty Fund, 1998.
Rothbard, Murray N. Power and Market: Government and the Economy. Mises Institute, 2006.
—. What Has Government Done to Our Money?. Mises Institute, 1990.
—. For a New Liberty: The Libertarian Manifesto. Mises Institute, 2006.
Tocqueville, Alexis de. Democracy in America. Translated by Harvey C. Mansfield and Delba Winthrop, University of Chicago Press, 2000.
Toynbee, Arnold J. A Study of History. Oxford University Press, 1934–1961.
«Warum Nationen entstehen und untergehen: Ein Überblick»